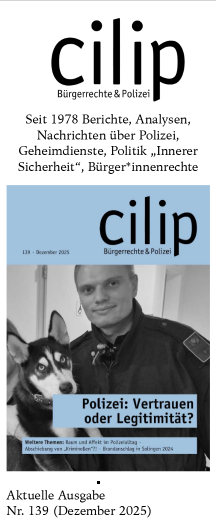Im Mai 2023 haben wir umfangreich über wichtige Neuigkeiten der Praxis von Polizeidrohnen in Niedersachsen berichtet. Es ging u.a. um die Entwicklung zum nunmehr regelmäßigen Einsatz von Polizeidrohnen bei Fußballspielen, um die öffentlich bis dato unbeachtet gebliebene massive Ausweitung des Polizeidrohnen-Fuhrparks in Niedersachsen und um ungenügende Kennzeichnung von Drohneneinsätzen. Um an die Informationen für diesen Beitrag zu gelangen hatten wir uns einen monatelang dauernden Telefon- und Mailverkehr mit dem Innenministerium geliefert.
Damals haben wir weitere Nachfragen an das zuständige niedersächsische Landespolizeipräsidium (LPP) im Niedersäschsischen Innenministerium gestellt, um Beantwortung bis zum 9.5.2023 gebeten und in unserem Beitrag noch geflachst:
„Noch in diesem Monat (Mai 2023) schafft das Innenministerium weitere 12 Drohnen an: „Die Polizei Niedersachsen plant alle Flächenbehörden mit ULS auszustatten.“ Was das genau bedeutet, welche Drohnentypen angeschafft werden und welche „Flächenbehörden“ mit jeweils wie vielen Polizeidrohnen ausgerüstet werden, das hat uns das Innenministerium bislang trotz Fristsetzung leider noch nicht beantwortet. Wenn die Antwortzeiten wie bei der letzten Presseanfrage liegen, können wir vielleicht im Juli 2023 mit Antworten rechnen …„
Daraus ist jetzt traurige Wahrheit geworden. Mehr als viereinhalb Monate hat sich das LPP Zeit gelassen, um uns unsere Nachfragen zu beantworten. Das Wichtigste daraus möchten wir hier als Ergänzung zum Mai-Blogbeitrag stichpunktartig zusammenfassen und der daran interessierten Öffentlichkeit weitergeben:
- Das „Landeskonzept zum Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen (ULS)“ ist vom 31.1.2022, also noch zu den Zeiten der rot-schwarzen Nds. Landesregierung unter dem ehemaligen Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD), jetzt Bundes“verteidigungs“minister entstanden.
- Darin heißt es angeblich wortgetreu – und das wäre eine der wenigen guten Nachrichten am Komplex: „Bei Versammlungen sind ULS nicht einzusetzen.“ Wobei dann dennoch die im Mai-Beitrag bereits skizzierte Problematik weiterhin bleibt, dass die Polizei selber definieren kann, wann sie als Versammlung wertet und was nicht. Uneindeutig ist diese Entscheidung zum Beispiel bei Fußballspiel-An- und Abreisesituationen.
- Das Landeskonzept ist nicht öffentlich und soll es auch nicht werden, denn es sei „polizeiintern“.
- Niedersachsen hat zuletzt 12 Stück DJI Mavic 3T eingekauft, jeweils ausgestattet mit einer fest verbauten Kamera mit Weitwinkel-, Digitalzoom- und Wärmebildfunktion. Die haben alle zusammen 88.086,83 € gekostet. Diese neue Drohnen werden auf die sechs Flächendirektionen der Polizei Niedersachsen verteilt.
- Die Entscheidung zu dieser Aufrüstung mit Polizeidrohnen wurde 2021 vom von Boris Pistorius geleiteten Innenministerium getroffen.
- Zu dieser Anschaffung wurde das Niedersächsische Parlament weder informiert noch wurde dort darüber debattiert.